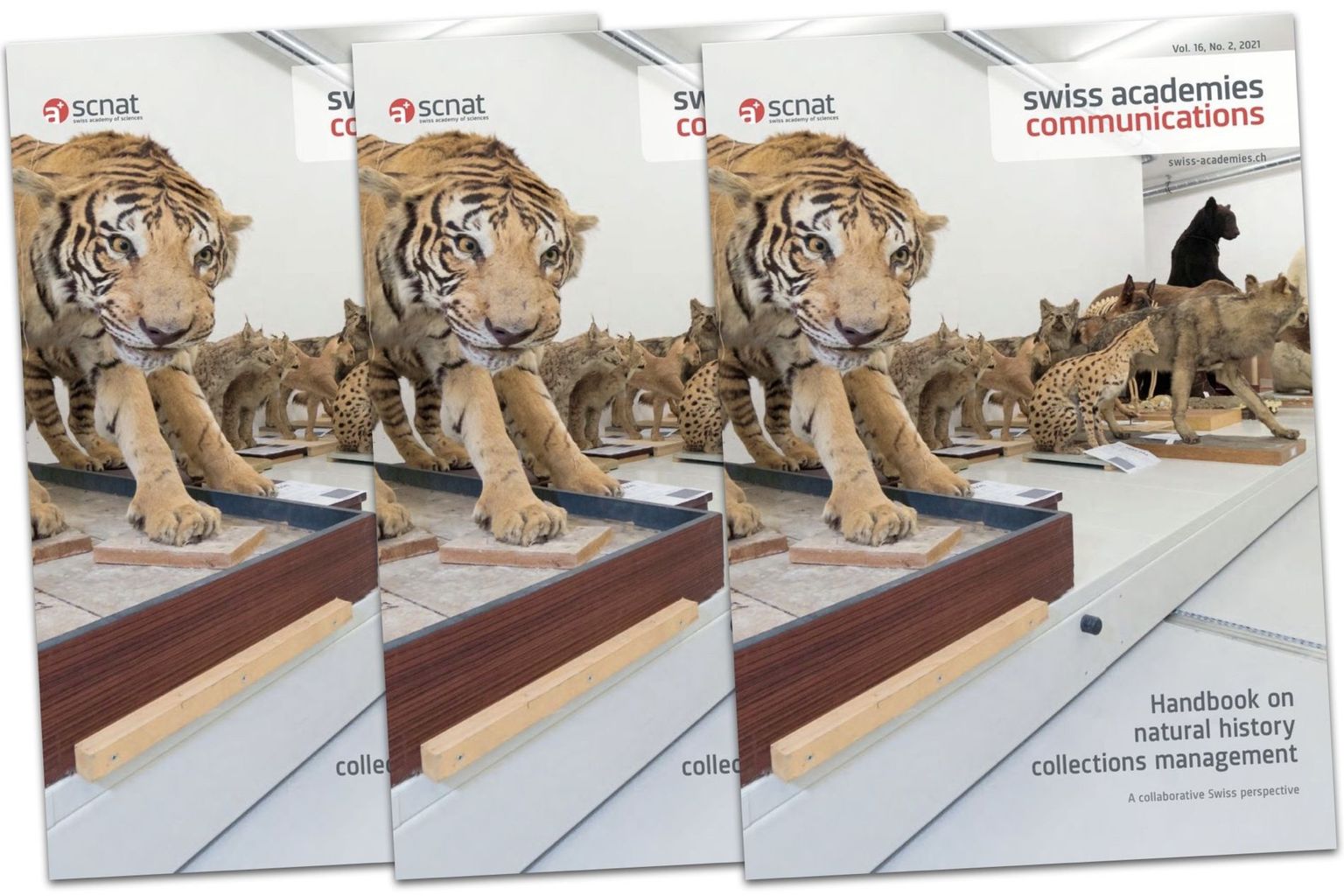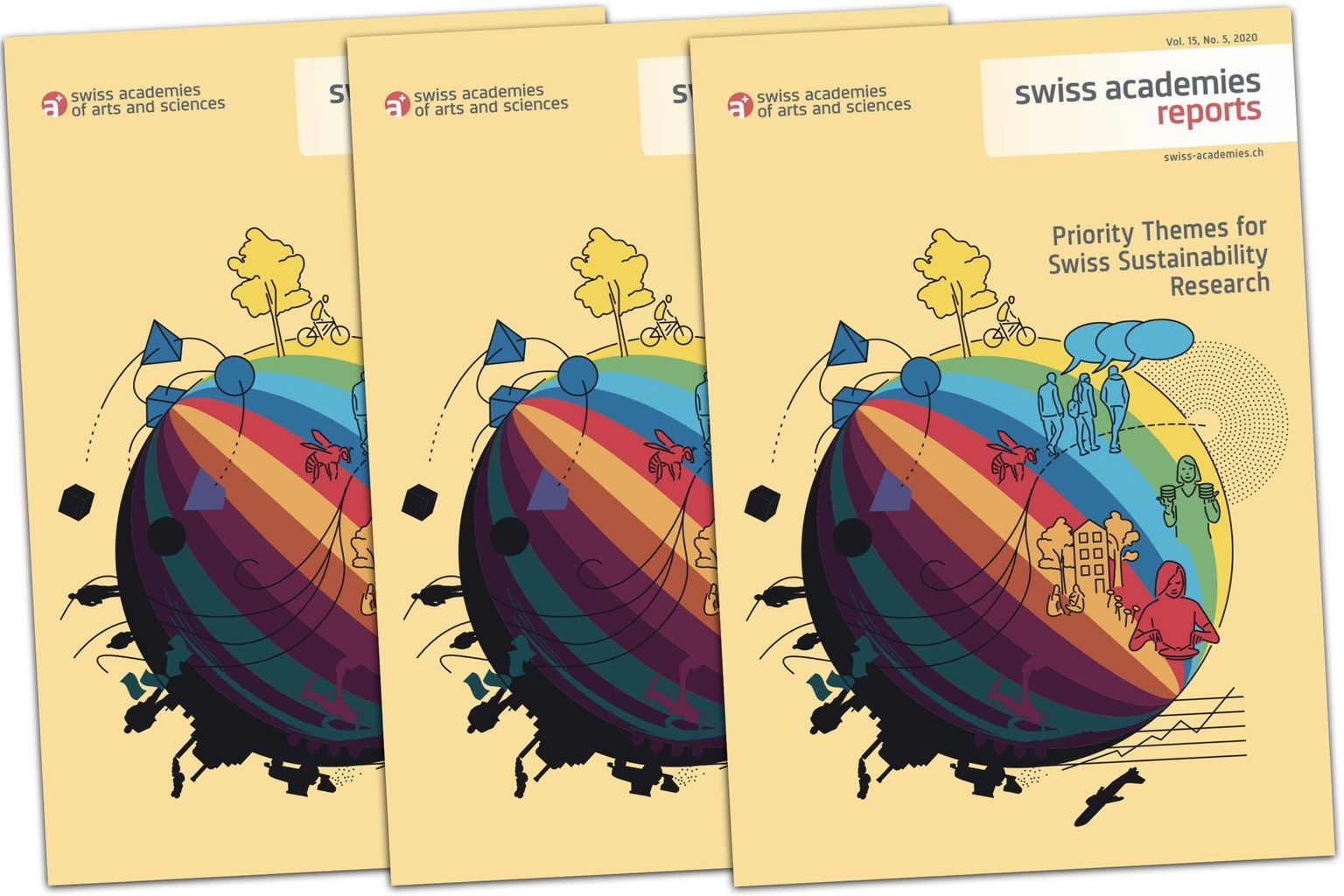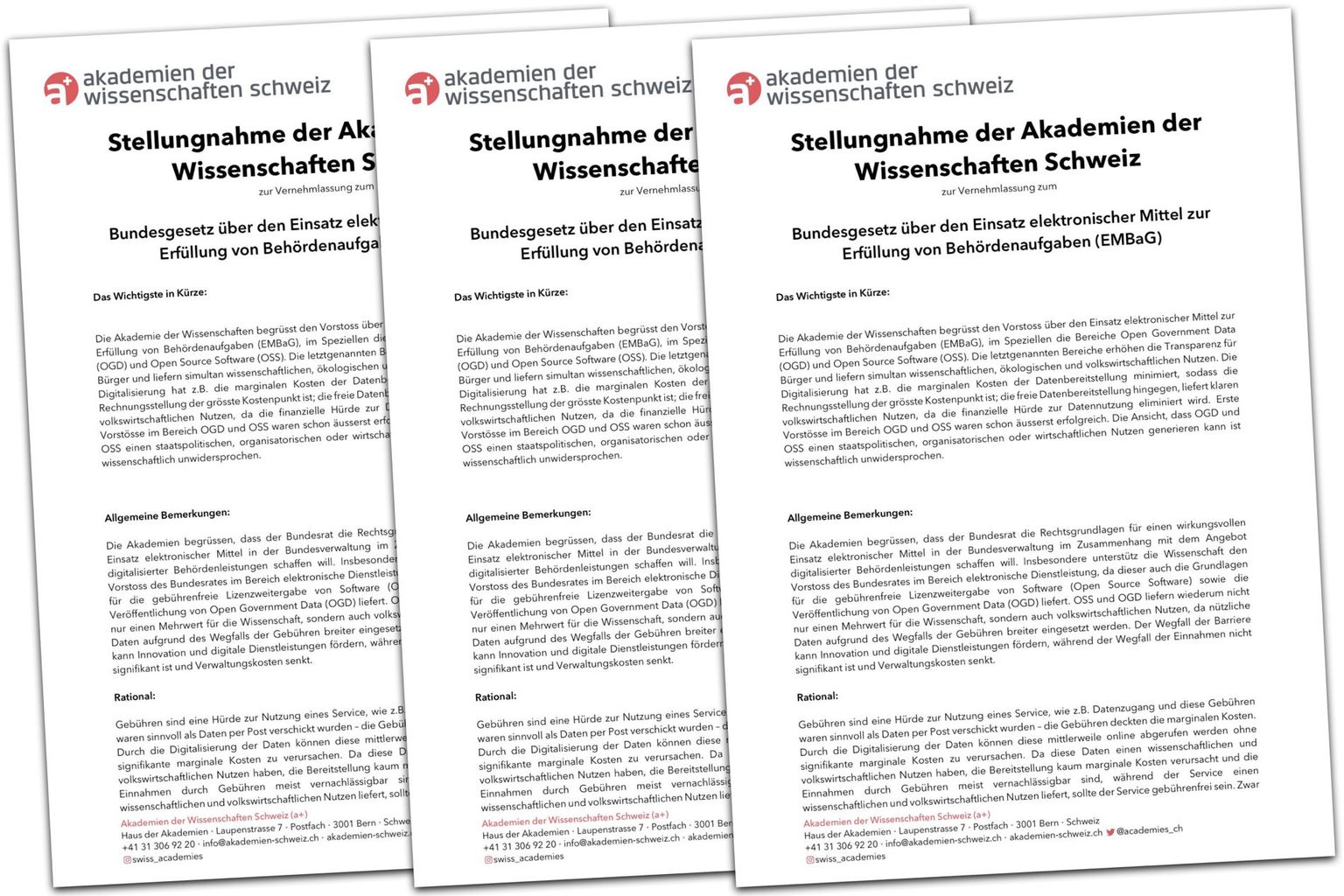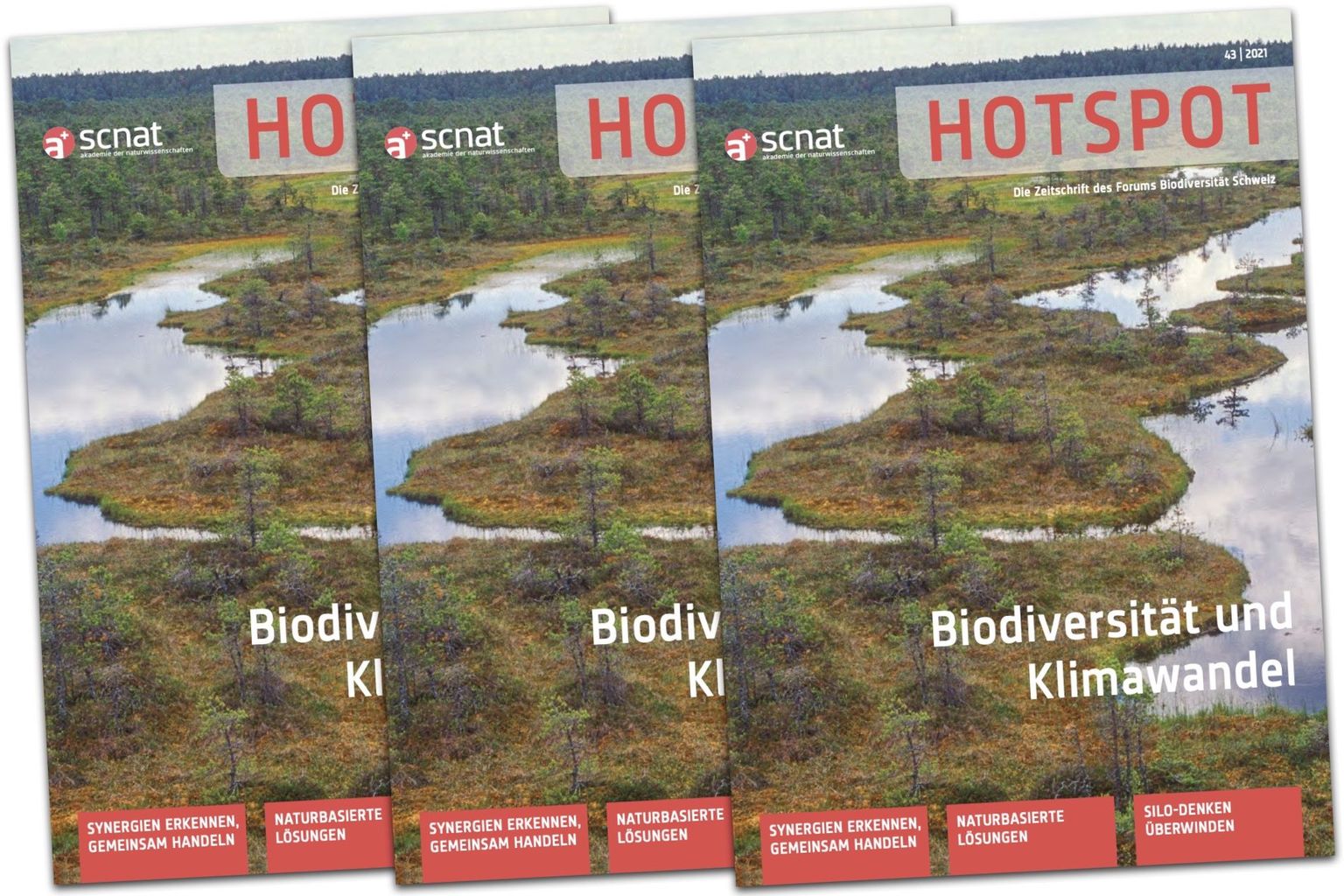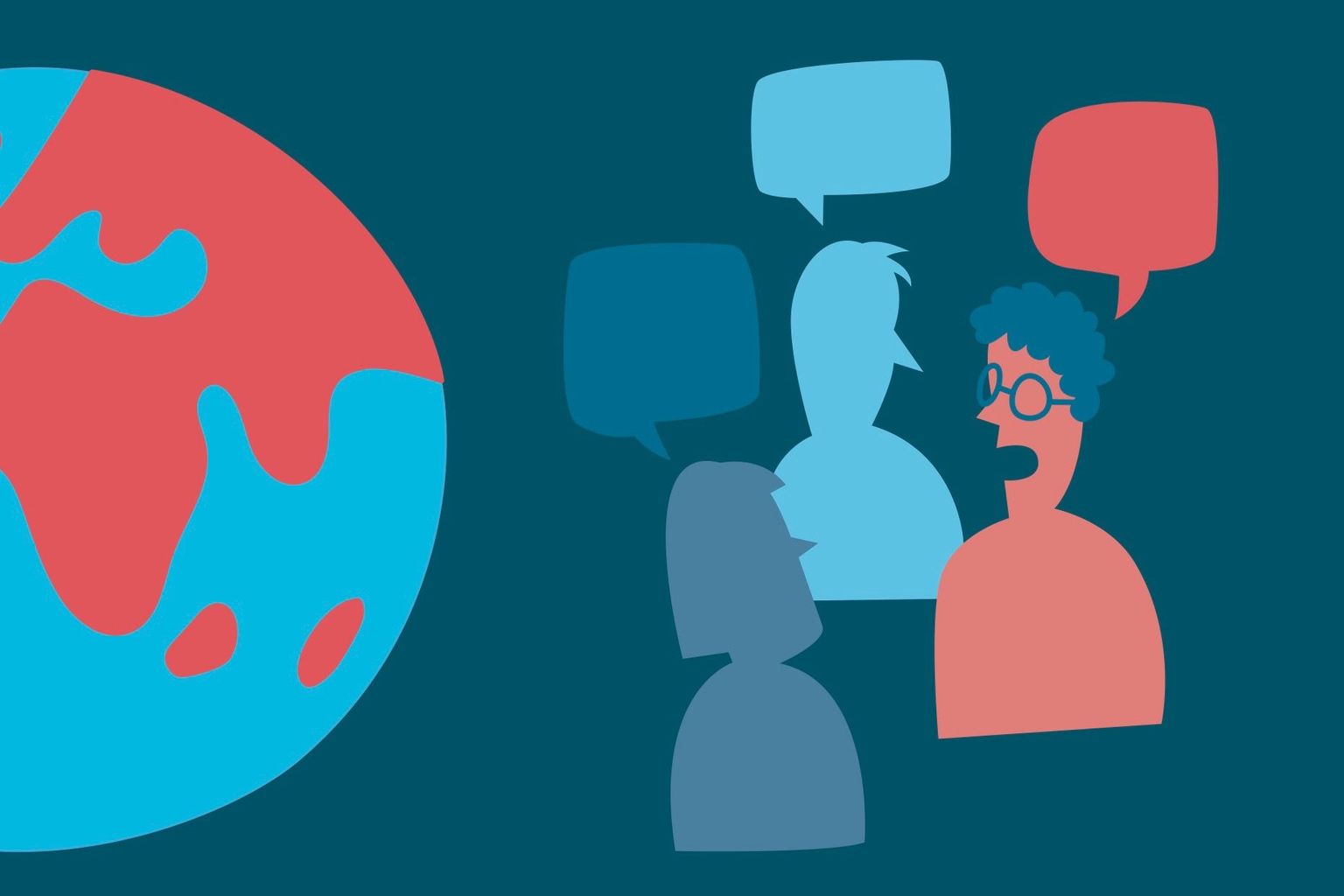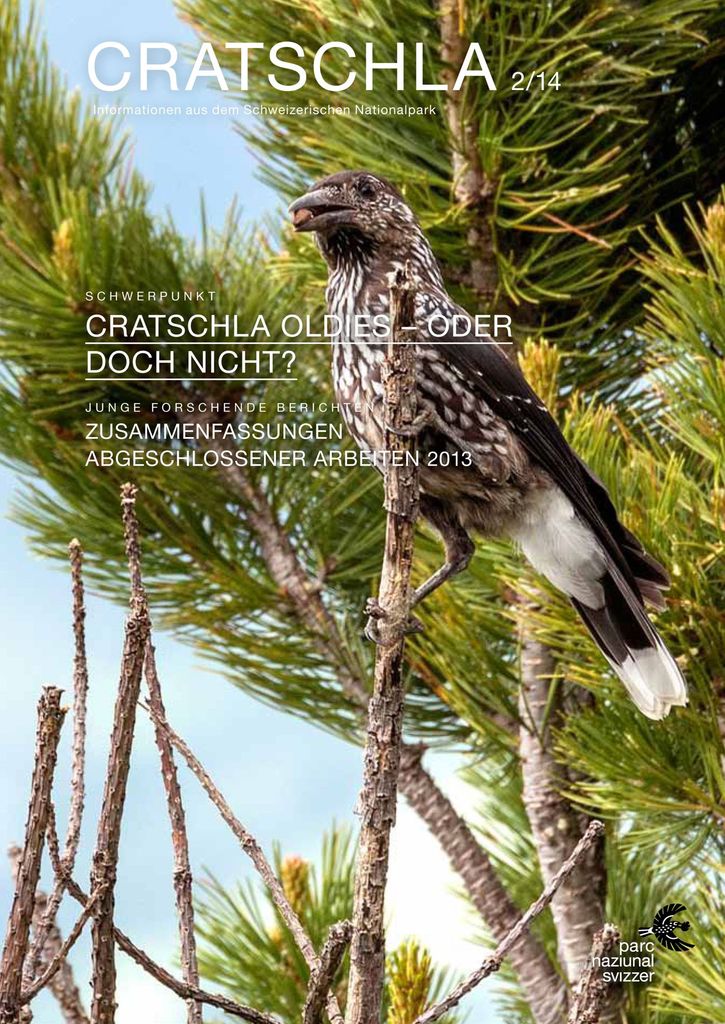Publikationen
Die Publikationen der SCNAT und ihres Netzwerks bieten Orientierungswissen zu gesellschaftlich und wissenschaftspolitisch relevanten Themen. Sie liefern verständlich aufbereitete Erkenntnisse aus der Forschung und informieren über den Stand des Wissens. Die Publikationen der SCNAT sind frei und kostenlos zugänglich.
Publikationen der SCNAT
Publikationen von Mitgliedsorganisationen
Kontakt
Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)
Haus der Akademien
Postfach
3001 Bern
Aktuell

Landscape-News 02|2026
Mit dem Landschafts-Canvas regionalwirtschaftliche Potenziale erschliessen, Soutien aux projets FoLAP, Landschaftsqualität im Licht gesellschaftlicher Narrative
Bild: regiosuisse
Cristina Benea – Quantenoptikerin
Cristina Benea nimmt uns mit in ihr Labor an der EPFL, wo sie in der Quantenoptik forscht und an photonischen Chips arbeitet.
Bild: Benedikt Vogel und SCNATInformationsdienst Biodiversität Schweiz IBS Nr. 192
100% nachhaltiger P!anzenschutz weltweit: Mehr Chancen als Risiken
Bild: Forum Biodiversität Schweiz
Trendwende Biodiversität – wie Veränderung gelingt
12.2.2026 – In dieser Folge spricht Host Cornelia Eisenach mit Markus Fischer, Professor für Pflanzenökologie an der Universität Bern und Ursina Wiedmer, Leiterin Fachstelle Naturschutz des Kantons Zürich darüber was es braucht, damit wir den Biodiversitätsverlust wirklich stoppen können.
Bild: Monique Borer
Landscape-News 01|2026
Ausschreibung Host-Institutionen 6. Schweizer Landschaftskongress 2028, Call for Papers ForumAlpinum 2026, Comment se porte la biodiversité en Suisse ?
Bild: Monika Flückiger
Biodiversität in der Schweiz verstehen und gestalten
Der vorliegende Bericht stellt den Zustand und die Veränderungen der Biodiversität in der Schweiz übersichtlich und differenziert dar. Gestützt auf Daten, Studien und Expertenwissen beschreibt er, wie sich die biologische Vielfalt in den verschiedenen Lebensräumen entwickelt hat. Der Fokus liegt auf den Veränderungen in den letzten 15 Jahren. Der Bericht zeigt zudem, welche Faktoren die Biodiversität derzeit am stärksten beeinflussen und welche Ereignisse in Politik und Gesellschaft dafür wichtig waren. Und er legt dar, wie wir die Weichen stellen können, damit kommende Generationen eine reichhaltige und funktionsfähige Biodiversität als Lebensgrundlage vorfinden.
Bild: SCNAT
Natasha Tomm – Quantenoptikerin
Natasha Tomm, Quantenoptikerin, spricht über ihre Rolle als angewandte Wissenschaftlerin und Projektmanagerin bei Zurich Instruments, über die Zusammenarbeit mit akademischen und industriellen Partnern sowie über die interdisziplinäre Natur der Quantentechnologien.
Bild: Benedikt Vogel und SCNAT